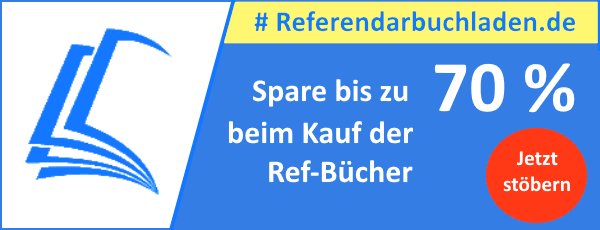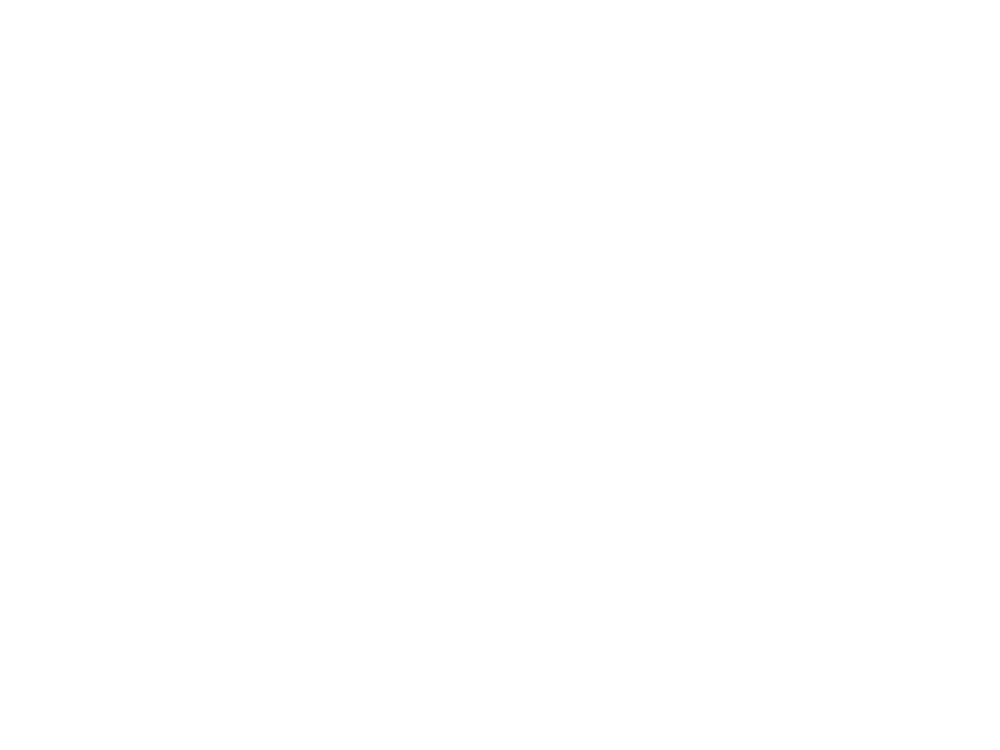26.07.2021, 22:33
Hallo Leute, in Prozessvergleichen kommt es ja häufig zur Vereinbarung von Verfallsklauseln. Der Gläubiger verzichtet auf einen Teil der Forderung, wenn der Schuldner die vereinbarten Tilgungsraten fristgemäß leistet. Klar ist, dass die Beweislast für den fristgerechten Eingang der Raten beim Schuldner liegt; deshalb muss sich der Gläubiger auch nur eine einfache Klausel nach § 724 ZPO erteilen lassen. Was mir noch nicht so ganz klar ist: Handelt es sich um eine aufschiebende oder auflösende Bedingung. In einem Artikel habe ich gelesen, dass es sich um eine auflösende Bedingung handele. Dann hätte der teilweise Verzicht aber doch schon Bestand, sodass der Gläubiger die Bedingung, welche den Verzicht auflöst, hier also das Fristversäumnis beweisen müsste? Ich würde es also eher als aufschiebende Bedingung qualifizieren, sprich der Verzicht wird solange aufgeschoben, bis der alle Raten fristgerecht gezahlt hat. Wie sehr ihr das?
27.07.2021, 16:59
(26.07.2021, 22:33)Gast schrieb: Hallo Leute, in Prozessvergleichen kommt es ja häufig zur Vereinbarung von Verfallsklauseln. Der Gläubiger verzichtet auf einen Teil der Forderung, wenn der Schuldner die vereinbarten Tilgungsraten fristgemäß leistet. Klar ist, dass die Beweislast für den fristgerechten Eingang der Raten beim Schuldner liegt; deshalb muss sich der Gläubiger auch nur eine einfache Klausel nach § 724 ZPO erteilen lassen. Was mir noch nicht so ganz klar ist: Handelt es sich um eine aufschiebende oder auflösende Bedingung. In einem Artikel habe ich gelesen, dass es sich um eine auflösende Bedingung handele. Dann hätte der teilweise Verzicht aber doch schon Bestand, sodass der Gläubiger die Bedingung, welche den Verzicht auflöst, hier also das Fristversäumnis beweisen müsste? Ich würde es also eher als aufschiebende Bedingung qualifizieren, sprich der Verzicht wird solange aufgeschoben, bis der alle Raten fristgerecht gezahlt hat. Wie sehr ihr das?
Grund für die Verwirrung ist vielleicht, dass verschiedene Bezugspunkte für die Bedingung möglich sind: der Vergleich könnte hinsichtlich des Mehrbetrags unter der auflösenden oder der Erlass des Mehrbetrags unter der aufschiebenden Bedingung stehen. Ich hätte es auch immer in letzterem Sinne verstanden und protokolliere das auch so ("Für den Fall... vereinbaren die Parteien schon jetzt den Erlass des darüber hinaus gehenden Forderungsbetrags").
Ich glaube aber nicht, dass diese Konstruktionen Auswirkungen auf die Beweislast haben - der Vergleich ist auszulegen, und nach der Verkehrssitte (157 BGB) soll der Gläubiger nie die Beweislast für die Nichtzahlung tragen - aus den von Dir genannten Gründen. Kontrollüberlegung: der Nichtwiderruf des Vergleichs ist aufschiebende Wirksamkeitsbedingung und trotzdem nicht vom Gläubiger zu beweisen!
Folgefrage: Macht es aber vielleicht immerhin einen Unterschied für den Rechtsbehelf des Schuldners gegen die Vollstreckung in voller Höhe? Erlass ist Vollstreckungsabwehrklage, wenn insoweit kein wirksamer Vergleich vorliegt, möglicherweise Titelgegenklage?
27.07.2021, 19:15
(27.07.2021, 16:59)Praktiker schrieb:(26.07.2021, 22:33)Gast schrieb: Hallo Leute, in Prozessvergleichen kommt es ja häufig zur Vereinbarung von Verfallsklauseln. Der Gläubiger verzichtet auf einen Teil der Forderung, wenn der Schuldner die vereinbarten Tilgungsraten fristgemäß leistet. Klar ist, dass die Beweislast für den fristgerechten Eingang der Raten beim Schuldner liegt; deshalb muss sich der Gläubiger auch nur eine einfache Klausel nach § 724 ZPO erteilen lassen. Was mir noch nicht so ganz klar ist: Handelt es sich um eine aufschiebende oder auflösende Bedingung. In einem Artikel habe ich gelesen, dass es sich um eine auflösende Bedingung handele. Dann hätte der teilweise Verzicht aber doch schon Bestand, sodass der Gläubiger die Bedingung, welche den Verzicht auflöst, hier also das Fristversäumnis beweisen müsste? Ich würde es also eher als aufschiebende Bedingung qualifizieren, sprich der Verzicht wird solange aufgeschoben, bis der alle Raten fristgerecht gezahlt hat. Wie sehr ihr das?
Grund für die Verwirrung ist vielleicht, dass verschiedene Bezugspunkte für die Bedingung möglich sind: der Vergleich könnte hinsichtlich des Mehrbetrags unter der auflösenden oder der Erlass des Mehrbetrags unter der aufschiebenden Bedingung stehen. Ich hätte es auch immer in letzterem Sinne verstanden und protokolliere das auch so ("Für den Fall... vereinbaren die Parteien schon jetzt den Erlass des darüber hinaus gehenden Forderungsbetrags").
Ich glaube aber nicht, dass diese Konstruktionen Auswirkungen auf die Beweislast haben - der Vergleich ist auszulegen, und nach der Verkehrssitte (157 BGB) soll der Gläubiger nie die Beweislast für die Nichtzahlung tragen - aus den von Dir genannten Gründen. Kontrollüberlegung: der Nichtwiderruf des Vergleichs ist aufschiebende Wirksamkeitsbedingung und trotzdem nicht vom Gläubiger zu beweisen!
Folgefrage: Macht es aber vielleicht immerhin einen Unterschied für den Rechtsbehelf des Schuldners gegen die Vollstreckung in voller Höhe? Erlass ist Vollstreckungsabwehrklage, wenn insoweit kein wirksamer Vergleich vorliegt, möglicherweise Titelgegenklage?
Vielen Dank, so wird ein Schuh draus. Ich habe auch nochmal nachgedacht und bin zum gleichen Ergebnis gekommen. Ich denke also auch, dass einfach darauf abgestellt wird, dass der Anspruch auf die Gesamtforderung verfällt (sich auflöst), wenn der Schuldner die Bedingung, also die termingerechte Zahlung der Raten bewirkt; dann tritt die ratenweise Erfüllung des Teilbetrages an die Stelle der eigentlichen Schuld; § 364 Abs. 1 BGB. Deshalb passt auch die Bezeichnung Verfallsklausel. Man könnte das m.E. aber auch über eine aufschiebende Bedingung konstruieren, sprich der Gläubiger stellt einen Teilerlass unter die aufschiebende Bedingung der termingerechten Ratenzahlungen; auch hier dürfte der Schuldner den Eintritt der Bedingung - ähnlich, wie bei einem Eigentumsvorbehalt - zu beweisen haben.
27.07.2021, 23:09
Für die Klausur wichtig (jedenfalls wenn ich korrigiere) ist eben, dass die Beweislast nicht vom Himmel fällt oder aus Begrifflichkeiten folgt, sondern Ergebnis der Vertragsauslegung ist, also wie die Parteien die Beweislast unter Berücksichtigung der erkennbaren Interessen und der Verkehrssitte verstehen mussten - nur wegen der Formulierung 
Was ich auch schon gelesen habe, ist dass Parteien vereinbaren, dass der Gläubiger vom Nachweis durch öffentliche Urkunden entbunden wird - das kommt dann auf das Gleiche raus.

Was ich auch schon gelesen habe, ist dass Parteien vereinbaren, dass der Gläubiger vom Nachweis durch öffentliche Urkunden entbunden wird - das kommt dann auf das Gleiche raus.
27.07.2021, 23:36
(27.07.2021, 23:09)Praktiker schrieb: Für die Klausur wichtig (jedenfalls wenn ich korrigiere) ist eben, dass die Beweislast nicht vom Himmel fällt oder aus Begrifflichkeiten folgt, sondern Ergebnis der Vertragsauslegung ist, also wie die Parteien die Beweislast unter Berücksichtigung der erkennbaren Interessen und der Verkehrssitte verstehen mussten - nur wegen der Formulierung
Was ich auch schon gelesen habe, ist dass Parteien vereinbaren, dass der Gläubiger vom Nachweis durch öffentliche Urkunden entbunden wird - das kommt dann auf das Gleiche raus.
Ja, genau der Nachweisverzicht in notariellen Urkunden mit Unterwerfungserklärung. Teilweise wird angenommen, dass er unwirksam sei, da er eine Beweislastumkehr bewirke; vgl. § 309 Nr. 12 ZPO. Er hat allerdings nur prozessuale Wirkung, sprich der Gläubiger muss die Voraussetzungen des § 726 ZPO nicht nachweisen. Auf die materielle Rechtslage wirkt er sich nicht aus, der Schuldner muss eben nur aktiv werden und im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage einwenden, dass die Vollstreckungsvoraussetzungen, also beispielsweise die Fälligkeit nicht vorliegt. Dann ist der Gläubiger wieder am Zug. Das ist dann im Übrigen mal ein Beispiel, wo Darlegung- und Beweislast nicht zusammenfallen. Hoffe, ich habe jetzt kein Bullshit geschrieben. Aber so ist es mir zumindest noch in Erinnerung. Finde es übrigens sehr stark, dass man auch als Praktiker noch Laune hat, sich in dieser Form über juristische Dinge auszutauschen.
27.07.2021, 23:37
(27.07.2021, 23:36)Gast schrieb:(27.07.2021, 23:09)Praktiker schrieb: Für die Klausur wichtig (jedenfalls wenn ich korrigiere) ist eben, dass die Beweislast nicht vom Himmel fällt oder aus Begrifflichkeiten folgt, sondern Ergebnis der Vertragsauslegung ist, also wie die Parteien die Beweislast unter Berücksichtigung der erkennbaren Interessen und der Verkehrssitte verstehen mussten - nur wegen der Formulierung
Was ich auch schon gelesen habe, ist dass Parteien vereinbaren, dass der Gläubiger vom Nachweis durch öffentliche Urkunden entbunden wird - das kommt dann auf das Gleiche raus.
Ja, genau der Nachweisverzicht in notariellen Urkunden mit Unterwerfungserklärung. Teilweise wird angenommen, dass er unwirksam sei, da er eine Beweislastumkehr bewirke; vgl. § 309 Nr. 12 ZPO. Er hat allerdings nur prozessuale Wirkung, sprich der Gläubiger muss die Voraussetzungen des § 726 ZPO nicht nachweisen. Auf die materielle Rechtslage wirkt er sich nicht aus, der Schuldner muss eben nur aktiv werden und im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage einwenden, dass die Vollstreckungsvoraussetzungen, also beispielsweise die Fälligkeit nicht vorliegt. Dann ist der Gläubiger wieder am Zug. Das ist dann im Übrigen mal ein Beispiel, wo Darlegung- und Beweislast nicht zusammenfallen. Hoffe, ich habe jetzt kein Bullshit geschrieben. Aber so ist es mir zumindest noch in Erinnerung. Finde es übrigens sehr stark, dass man auch als Praktiker noch Laune hat, sich in dieser Form über juristische Dinge auszutauschen.
*309 Nr. 12 BGB
28.07.2021, 14:01
Danke :)